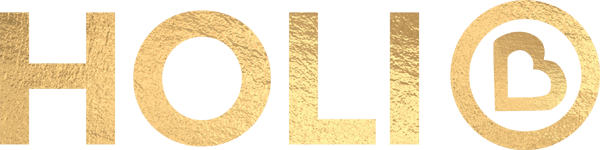Ein Praxisbeispiel: Emotionen – Fluch und Segen zugleich?
In meiner Beratung hatte ich einmal eine Familie mit einem 4,5-jährigen Kind, das wir hier K. nennen. Beim Erstgespräch zeigte sich K. offen und zugänglich. Die Eltern hatten mich aufgesucht, da K. in den vergangenen Monaten mit verschiedenen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte.
Der Kindergartenbesuch war eher Kampf als Freude. Die Eingewöhnung nach dem Kindergarteneintritt dauerte etwa vier Monate. Innerhalb eines Jahres wurde K. dann in eine andere Gruppe versetzt. Zwar war diese zweite Eingewöhnung weniger mühsam als die erste, jedoch immer noch belastend. Nun stand K. erneut vor einer Eingewöhnungsphase, was das Kind zunehmend verweigerte. Täglich wollte K. nicht in den Kindergarten gehen. Wenn die Mutter es schließlich überredete, klammerte sich K. im Flur an sie und wollte sich unter keinen Umständen trennen – unabhängig von Versprechungen oder Ablenkungsversuchen.
Auch die Beziehung zum Vater hatte sich drastisch verändert. K., einst ein fröhliches Kind, das gerne Zeit mit dem Vater verbrachte, schien wie ausgewechselt: kein Interesse mehr an gemeinsamen Aktivitäten, keine Nähe, keine Spiele. Nur gelegentlich ließ sich K. je nach Stimmungslage darauf ein. Der Vater berichtete von Gefühlsausbrüchen des Kindes, bei denen er sich hilflos fühlte.
Die Veränderungen zeigten sich auch beim Essen. K. begann, Nahrungsmittel akribisch zu untersuchen und bestand darauf, dass diese hygienisch einwandfrei und im Mindesthaltbarkeitszeitraum waren. K. bevorzugte etwa die dritte oder vierte Scheibe Brot und vermied die ersten, aus Angst, sie könnten schlecht sein. Insgesamt war K.'s Essverhalten stark reduziert.
Im Erstgespräch erlebte ich K. als überdurchschnittlich entwickeltes Kind – sowohl körperlich als auch kognitiv. Auffällig war jedoch die emotionale Labilität: K. wechselte oft und schnell zwischen Gefühlen wie Traurigkeit, Ablehnung und Nähebedürfnis. Alleine beschäftigen konnte sich K. kaum; immer wieder suchte es die Nähe zur Mutter.
Die familiäre Atmosphäre wirkte trotz dieser Herausforderungen wohlwollend und verständnisvoll.
Entwicklungsprozesse verstehen
Um K.'s Verhalten einzuordnen, recherchierte ich zu den relevanten Entwicklungsphasen. K. befand sich in der sogenannten Autonomiephase, auch Trotzphase genannt. Diese Phase ist entscheidend für die Entwicklung von Denken, Fühlen und Handeln.
Bis zum Alter von etwa vier Jahren entwickeln Kinder bereits eine Art „Lebensskript", das ihre Bedürfnisse nach Struktur, Zuwendung, Anerkennung sowie körperlicher und seelischer Stimulation beschreibt. Mit 4,5 Jahren war K. in einer Erprobungsphase: Es testete, wie das Umfeld auf sein Verhalten reagierte – und umgekehrt. Dabei kommen grundlegende Bedürfnisse zum Tragen, wie:
- klare Regeln und Abläufe,
- authentische Bezugspersonen,
- Berechenbarkeit im Verhalten der Erwachsenen,
- spontanes Lob,
- Freunde,
- Anerkennung für erbrachte Leistungen sowie
- Input durch neue Erfahrungen.
Neben den theoretischen Aspekten der Entwicklungsphase fiel mir ein weiterer, individueller Faktor bei K. auf: sein ausgeprägtes affektiv-emotionales Empfinden. K. hatte die Fähigkeit, seine Umwelt stark über Emotionen wahrzunehmen. Diese Eigenschaft ist angeboren und nicht konditionierbar.
Herausforderungen und Chancen von Emotionen
Aus diesen Erkenntnissen leitete ich zwei zentrale Punkte ab:
1. Die Autonomiephase als Fenster zur Reifung:
K. befand sich in einem Spannungsfeld zwischen vertrautem Verhalten und der Erkundung neuer, unbekannter Freiräume. Bindung und Loslösung wechselten sich als Teil der Entwicklung zu einem eigenständigen Individuum ab.
2. Emotionen als Fluch und Segen:
Emotionen dienten K. einerseits als wichtige Antennen zur Wahrnehmung seines Umfelds, andererseits erschwerten sie soziale Interaktionen. Bei emotionalen Überwältigungen zog sich K. zurück, um innerlich Klarheit zu finden. Während solcher Phasen war rationales Verhalten nicht zu erwarten. K. beobachtete sein Umfeld genau, um Reaktionen zu analysieren und in sein Lebensskript zu integrieren – ganz nach dem Prinzip: Aktion – Reaktion, oder: Wenn – Dann.
Wie das Umfeld auf K.'s Verhalten reagiert, hinterlässt eine Art „unsichtbare Unterschrift". Diese prägt nicht nur K.'s Überzeugungen und Glaubenssätze, sondern auch sein zukünftiges Verhalten. Menschen mit stark ausgeprägter emotionaler Wahrnehmung sind ein Leben lang von solchen Prägungen beeinflusst.
Fazit
Die Begleitung von Entwicklungsphasen wie der Autonomiephase ist entscheidend, um eine stabile Grundlage für die persönliche Entfaltung zu schaffen. Der richtige Umgang mit Emotionen – sie zu beachten und zu verstehen – eröffnet eine neue Dimension des Miteinanders. Diese Erkenntnis bereichert sowohl die Betroffenen selbst als auch ihre Bezugspersonen.
Das Fallbeispiel zeigt nur einen Ausschnitt von K.'s Persönlichkeit. Es gibt viele weitere Aspekte, die K. als individuellen Menschen ausmachen – so wie bei jedem von uns.
Ich möchte dazu ermutigen, aus Nichtwissen bewusstes Wissen zu machen. Nur so können wir zu selbstbewussten Menschen heranwachsen und ein tieferes Verständnis füreinander entwickeln.
Gratiela Niecznick